AM HERZEN EUROPAS 8
Rätoromanische Anthologie
DA LAS FUNTANAS
VON DEN QUELLEN

90 Seiten, broschiert
2006
Auflage: 300 Stück, € 19
ISBN 3-901735-19-4
ISBN 978-3-901735-19-6
Die Rätoromanen in der Schweiz
Noch sind sie da und schreiben Gedichte
In einer grossen Schweizer Tageszeitung ist vor einigen Jahren ein Artikel erschienen, der mit einer Zeichnung
illustriert war. Dargestellt war ein Stau auf einer Autobahn. Die Fahrzeuge reihten sich zwei- und dreispurig neben-
und hintereinander, und jedes hatte auf dem Dach ein oder mehrere Fahrräder. Die Legende zur Zeichnung lautete:
"Statistik: In der Schweiz sind immer mehr Fahrräder unterwegs." Ein bisschen "cum grano salis"
- und mit weniger Aufgeregtheit - sollte man vielleicht auch die Statistiken zum Bündnerromanischen, das heisst
des in Graubünden gesprochenen Rätoromanisch, betrachten. So werden sich denn unter den 51.128 Personen
im Jahr 1980, als in den eidgenössischen Volkszählungen noch nach der "Muttersprache" gefragt
wurde, auch ein paar Heimwehbündner zum Romanentum bekannt haben. Seitdem nach der "am besten beherrschten
Sprache" gefragt wird, hat sich die Zahl der Romanen auf 35.095 im Jahre 2000 reduziert, obwohl vielleicht
der eine oder andere das Romanische neben dem Deutschen zwar nur am zweitbesten, aber immer noch besser kann als
die vorherigen "Muttersprachler". Allerdings ist eine imposantere Zahl natürlich geeigneter, um
Ansprüche auf staatliche Förderungsmassnahmen durchzusetzen. Aber auf den stattlichen Anteil von über
650.000 Personen in der Schweiz, die eine andere als eine der vier Landessprachen sprechen, wird es das Romanische,
wie auch immer gefragt wird, nie mehr bringen.
|

|
|
Seite 16/17, zum Vergrößern anklicken
|
Aus historischen Gründen ist das kleine Grüppchen der Bündnerromanen auch noch
weiter aufgesplittert, in Angehörige von fünf, zum Teil sich ziemlich stark voneinander unterscheidenden
(normierten Schrift-) Idiomen. Das kommt daher, dass das seit der römischen Kolonialisierung entstandene Rätoromanisch
bis zu seiner Verschriftlichung im Zuge der Reformation und Gegenreformation sich in den geografisch getrennten
Gebieten bereits stark auseinanderentwickelt hatte und dann in diesem Zustand - also um in jeder Region das Wort
Gottes in der "Sprache ihres Volkes" verkünden zu können - fixiert und weiter tradiert wurde.
Bisherige Versuche, eine bündnerromanische Einheitssprache zu schaffen, sind alle gescheitert. Ein neuer Versuch
wird seit 1982 unternommen. Nur als überregionale Kanzleisprache und für den plakativen Gebrauch, wie
es immer hiess - also beispielsweise um zu wissen, in welcher Sprachvariante man die schweizerischen Geldscheine
oder etwa die Rhätische Bahn beschriften sollte -, wurde eine Koiné geschaffen. Nun hat sich die Bündner
Regierung - seltsamerweise unter Einfluss der Lia Rumantscha, der Dachorganisation der bündnerromanischen
Sprachvereinigungen, die ebenfalls darin das Heil sieht - dazu verstiegen, dieses "rumantsch grischun",
wie die Koiné heisst, zur Standardsprache befördern zu wollen und sogar innerhalb der nächsten
zehn Jahre die Kinder in einer Sprache zu alphabetisieren, die kein Mensch spricht. Ungeachtet aller Proteststürme
(Petition, offener Brief von 180 Intellektuellen, konsultative Referenden, parlamentarische Anfragen) und obwohl
die Regierung mittlerweile zugeben musste, dass die Entscheidungskompetenz für die Schulsprache gar nicht
beim Kanton, sondern bei den Gemeinden liegt, hält sie - und auch die Lia Rumantscha - vorläufig an einem
Entscheid fest, der niemals verwirklicht werden kann. Erstens kann man Sprachpolitik nicht ohne die Sprecher betreiben.
Zweitens hatte in der bisherigen Sprachgeschichte schon immer eine prestigeträchtige Variante (Sprache des
Hofes, der Hauptstadt, der Oberschicht usw.) die Chance, zur Standard- beziehungsweise Hochsprache zu werden, und
nicht eine verordnete. Und drittens pflegt in der Regel der Sprachgebrauch der Sprachnorm vorauszugehen, nicht
umgekehrt. Wohin es führt, wenn man den Leuten gegen ihre Sprachgewohnheiten befiehlt, wie was nun künftig
richtig zu heissen hat, konnte man soeben bei der deutschen Orthographiereform erfahren. Man wird deshalb die Prognose
wagen dürfen: Solange das Bündnerromanische lebt, wird es - Nachteile hin oder her - mit seinen verschiedenen
geschriebenen Idiomen weiterleben. Und auch künftige Anthologien bündnerromanischer Literatur werden
- wie die hier vorliegende - Texte in verschiedenen Varianten enthalten.
Einer der Nachteile der Aufsplitterung in fünf (Schrift-)Idiome ist für bündnerromanische Schriftstellerinnen
und Schriftsteller, dass sie sich nur an ein sehr kleines Leserpublikum wenden können. So verlegen die Autoren
der beiden grössten Idiome ("sursilvan" im Bündner Oberland und "vallader" im Unterengadin)
ihre Werke in etwa 2000 beziehungsweise nur 700 Exemplaren. Auflagen von 500 Exemplaren für "puter"
schreibende Autoren (Oberengadin, etwa noch 3500 Sprecher) werden bereits als zu gross erachtet. Und die überregionale
Variante "rumantsch grischun" scheint übrigens nicht einmal zur Erweiterung des Leserkreises zu
taugen. Der vor kurzem verstorbene Engadiner Schriftsteller Clo Duri Bezzola hatte sich nach der Publikation eines
Gedichtbandes in dieser Einheitssprache bitter beklagt, nun lese ihn überhaupt niemand mehr, nun habe er für
alle "nicht unser Romanisch" geschrieben. Mehr Erfolg versprechen sich die Autoren offenbar von zweisprachigen
Ausgaben (Idiom und Deutsch), was in letzter Zeit vermehrt gemacht wird.
|
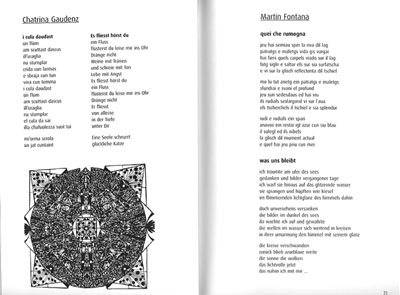
|
|
Seite 20/21, zum Vergrößern anklicken
|
Die kleine Zahl der potentiellen Leserinnen und Leser bringt es mit sich, dass, will man wahrgenommen
werden, man auch zu Konzessionen bereit sein muss. So schreiben bündnerromanische Autorinnen und Autoren im
Spannungsfeld zwischen
Publikumserwartungen und ästhetischen Ansprüchen und schliesslich auch noch zwischen der ihnen traditionell
auferlegten Verpflichtung zum Engagement für die "chara lingua da la mamma" (geliebte Muttersprache).
Denn entstanden ist die eigentliche belletristische bündnerromanische Literatur im Zuge der sogenannten "Rätoromanischen
Renaissance" ab etwa 1860. Die Gründung des Kantons Graubünden von 1803 hatte vorübergehend
eine gewollte Schwächung des Romanischen zur Folge. Gewisse Kreise sahen die Möglichkeit des "Anschlusses
an die Welt" nur durch die Ausrottung dieser "Bauernsprache" gewährleistet. Im Nachvollzug
der deutschen Romantik - mit ihrer Verehrung des Ursprünglichen, des Volkstümlichen und des "Mutterlauts"
- entstand aber 1863 die Societä Retorumantscha und mit ihr eine Bewegung, die zwecks Erhaltung der Sprache
auch eine literarische Produktion förderte.
Verlage gab es allerdings damals keine. Die Societä Retorumantscha gibt seit 1886 ein Jahrbuch heraus, in
dem lange Zeit auch nicht allzu umfangreiche literarische Arbeiten Platz fanden. Die bündnerromanischen Verlagshäuser
entstanden seit den 1950er Jahren - und es gibt sie grösstenteils schon wieder nicht mehr. Als erster baute
der Desertina Verlag in Disentis, der Herausgeber der "Gasetta romontscha", seit 1953 seine Verlagstätigkeit
aus. Ein zweiter Verlag, die Ediziuns Fontaniva, wurde 1963 wegen Streitigkeiten um eine Orthographiereform in
der Surseiva gegründet. Sie wollte schriftlich nachvollziehen, was mündlich bereits etabliert war: die
Unterscheidung zwischen den Präpositionen "de" (la casa de miu bab, das Haus meines Vaters) und
"da" (la casa da crap, das Haus aus Stein) sollte zugunsten von "da" fallen gelassen werden.
Die "de-da-Autoren" blieben bei Desertina, die "da-Autoren" gingen zu Fontaniva.
Auch heute ist die Bereitstellung von Lesestoff - nicht nur von literarischen Texten, sondern auch von täglich
erscheinenden Zeitungsberichten - ein wichtiges Instrument zur Erhaltung der Sprache. So wurde beispielsweise,
einhergehend mit einem neuen Sprachengesetz, 1996 die Presseagentur "Agentura da novitads rumantscha"
gegründet. Sie wird finanziert mit einem jährlichen Beitrag von etwa einer Million Franken (etwa 630.000
Euro) von der Schweizerischen Eidgenossenschaft und vom Kanton Graubünden, was allerdings wenig ist. Zum Vergleich:
Das romanische Radio und Fernsehen bekommt 22 Millionen Franken von der öffentlichen Hand.
Die Zahlen führen uns zum Schluss wieder in die Nähe der eingangs etwas belächelten Statistik. Für
Massnahmen zur Förderung des Romanischen und des Italienischen im Kanton Graubünden wurden für das
Jahr 2006 etwa 7,15 Millionen Franken (etwa 4,5 Millionen Euro) veranschlagt. Etwa zwei Drittel davon steuert die
Schweizerische Eidgenossenschaft, ein Drittel der Kanton bei. Von diesem Geld erhält die Lia Rumantscha über
2,4 Millionen Franken, die Pro Grigioni Italiano (die Organisation der italienisch sprechenden Bündner) etwa
850.000 Franken. Der Finanzbedarf für die "Förderung der Verlagstätigkeit" - was nur die
Herausgabe von Schulbüchern betrifft; in den romanischen Gebieten ist der Unterricht bis zur vierten Klasse
nur romanisch - wird mit etwa 500.000 Franken ausgewiesen. Die Kosten für die Produktion der ebenfalls der
Sprachförderung dienenden belletristischen Literatur wird den Autoren überlassen, die teilweise - meistens
unter der Bedingung, dass sie bereit sind, sich von den Geldgebern ihre Texte "verbessern" zu lassen
- auf eine gewisse Unterstützung kultureller Institutionen zählen können.
Lucia Walther
geboren 1949 in Zürich und dort aufgewachsen. Studium der Germanistik, des Rätoromanischen
und der Literaturkritik an der Universität Zürich. Promotion mit einer Arbeit über deutsch-rätoromanischen
Sprachkontakt. Zusammen mit Iso Camartin und Clä Riatsch Mitarbeit an einem Projekt des Schweizerischen Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Die Resultate sind publiziert unter dem Titel "Literatur
und Kleinsprache - Studien zur bündnerromanischen Literatur seit 1860" (1993). Anschliessend wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Universität Zürich und am Schweizerischen Literaturarchiv in Bern. Beiträge
und Aufsätze in verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden. Seit 1997 Korrespondentin der romanischen
Presseagentur "Agentura da novitads rumantscha" im Engadin (GR).
Raeter und Romanen in Tirol
In Landeck gibt es eine katholische farbentragende Mittelschulverbindung, gegründet 1946, mit dem Namen Raeto
- Romania. Wie ist das zu erklären? Während allgemein bekannt ist, was man unter dem Volk der Romanen
versteht, erhebt sich die Frage: Gibt
oder gab es auch ein Volk der Raeter? Nach Studien an der Universität Innsbruck waren die Raeter kein eigenes
Volk. Sie waren selbst bereits ein "Mischvolk" von Kelten - und Etrusker ähnlichen Völkerschaften.
Es gibt in der Gegend des Achensees Inschriften eines Wasserheiligtums, die den Etruskem zugeordnet werden:
Mangels anderer Unterlagen und Quellen kann wohl nur vergleichende Sprachwissenschaft nähere Auskunft darüber
geben. Zum ersten Mal erscheint das Wort "raetisch" bei Cato dem Älteren, der den raetischen Wein
lobt. Als Kerngebiet der "Raeter" wurde von den römischen Autoren zunächst das Gebiet des Etschtales
nördlich von Verona angesehen, während nach dem Alpenfeldzug des Drusus und Tiberius (15 v. Chr.) auch
die Bewohner nördlich des Alpen-Hauptkamms als "Raeter" bezeichnet wurden. Die von den Römern
gegründete Provinz " Raetia" umfasste in etwa das heutige Graubünden, Süd- und Nordtirol,
sowie das Alpenvorland zwischen Schwäbischer Alb und dem Inn nördlich von Kufstein. Unter Kaiser Augustus
wurde die Nordgrenze der Provinz Raetia die Donau. Die Bewohner im Räume Landeck waren also vor dem Einzug
der Romanen Indogermanen mit keltischen und etruskischen Einflüssen.
Zahlreiche Funde im Alpengebiet, auch direkt in Landeck, z. B. im heutigen Ortsteil Perjen belegen, dass die Römer
das Land nicht nur eroberten, sondern offenbar auch viele romanische Siedler das Gebiet für sich in Anspruch
nahmen, so dass es ziemlich sicher zu einer Vermischung dieser beiden Völker kam. Nach dem heutigen Stand
kann man diese neu entstandene Mischform, um einen einfachen Zusammenhang herzustellen, wirklich als "Raeto-Romanen"
bezeichnen. Ab dem 5., 6. Jahrhundert begann dann die Besiedelung des Tiroler Raums durch die Bajuwaren. Diese
Mischung aus den drei Volksgruppen dokumentieren für den Raum Landeck auch einige Flurnamen, so sind Angedair,
Perjen und Thial keltischen, Quadratsch, Kristille, Perfuchs, Riefe römischen, Bruggen, Burschi und Stampfle
bairischen Ursprungs.
|
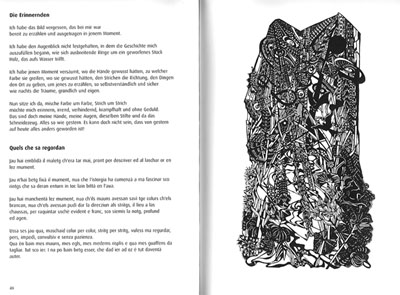
|
|
Seite 48/49, zum Vergrößern anklicken
|
Heute gibt es in einigen Alpentälern Formen dieser "raetisch-romanischen" Sprache,
wie das Ladinische im Dolomitengebiet, im Friaul oder "Romansch" im Engadin. Auch im Raum Nordtirol hielt
sich diese hier leider jetzt nicht mehr verwendete Sprache zumindest bis ins 19. Jahrhundert, da nach den Erzählungen
meines Vaters, der den entsprechenden Brief als Student in Brixen selbst gesehen hatte, den der in den 1870er Jahren
in Serfaus neu installierte Pfarrer von Serfaus an seinen Fürstbischof von Brixen geschrieben hatte. "Was
soll ich hier, wo etwa die Hälfte der Bevölkerung raetoromanisch spricht und deutsch gar nicht verstehen
kann?"
Es war daher wohl eine begrüßenswerte Initiative der damaligen Gründungsväter der eingangs
erwähnten Studentenverbindung, dass der historisch begründete Name "Raeto-Romania" gewählt
wurde. Es zeigte einerseits die Tradition dieser Vereinigung ebenso auf und andrerseits sollte die Gründung
dieser Verbindung der Nachkriegsgesellschaft wohl dokumentieren, dass es katholische Farbstudenten auf der einen
Seite wie Sozialdemokraten auf der anderen Seite sind, die durch ihren gemeinsamen Aufenthalt in den Konzentrationslagern
Nazideutschlands das "Lagerdenken" der Zwischenkriegszeit überwanden und nach dem Krieg ein neues
Österreich aufbauten.
So kann man es nicht als Wunder, sondern als erfreuliches Ergebnis des Lernens aus der Geschichte ansehen, dass
junge Leute von dieser Studentenverbindung in Landeck angesprochen wurden und diese nicht nur im Raum Landeck,
sondern auch in vielen weiteren Gebieten Österreichs die "neue Heimat" nach den Bürgerkriegen
der Zwischenkriegszeit, nach den Zerstörungen des zweiten Weltkriegs und nach dem schrecklichen und menschenverachtenden
Regime der Naziherrschaft dieses Nachkriegsösterreich aufbauten. Wichtig für die Menschen unseres Landes
ist daher sicher sich auf die Vorbesiedlung unserer Heimat durch die Räter, Romanen und Bajuwaren zu besinnen;
noch wichtiger jedoch ist, sich mit der Jetztzeit auseinanderzusetzen und sich Ziele der Gegenwart zu setzen.
Es ist nach meiner Erkenntnis wichtig, dass der Einzelne sich der Würde seines Nächsten bewusst ist,
dessen Meinung respektiert und so die Grundlage für ein "Miteinander" schafft. Vielleicht sollte
man an eine Blumenwiese im Frühjahr denken, wo gerade die vielfältigen, vielfarbigen, lang- und kurzstieligen
Blumen die Harmonie bewirken, die unser Auge erfreut. So ähnlich könnte man sich das Zusammenleben der
verschiedenen Menschen in ihrer Gesamtheit vorstellen.
Dr. Hermann Schöpf
geboren 1936, Studium an der Universität Innsbruck, Promotion zum Dr. jur. 1969 - 2002 Rechtsanwalt in Landeck.
Seit März 2002 Studium der Geschichte an der Universität Innsbruck, derzeit an der Diplomarbeit.


